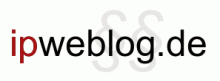Anzeigen:
Seitenleiste
Ergänzender wettbewerblicher Leistungsschutz
Unlauter handelt, wer Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er
a) eine vermeidbare Täuschung [→ Vermeidbare Herkunftstäuschung] der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,
b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt [→ [Rufausbeutung, → → Rufschädigung] oder
c) die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
§ 4 Nr. 3 lit. a UWG → Vermeidbare Herkunftstäuschung
§ 4 Nr. 3 lit. b UWG → Rufausbeutung, Rufschädigung
§ 4 Nr. 3 lit. c UWG → Unredliche Erlangung
→ Wettbewerbliche Eigenart
→ Anspruchsberechtigter im wettbewerblichen Leistungsschutz
→ Wettbewerbswidrige Umstände im ergänzenden Leistungsschutz
→ Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers
→ Voraussetzungen einer unlauteren Nachahmung
→ Sklavische Nachahmung
→ Begriff der Waren und Dienstleistungen im wettbewerblichen Leistungsschutz
→ Verhältnis des Leistungsschutzes zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster
→ Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz
→ Gegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes
→ Anspruchsberechtigter im wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz
→ Klageantrag im wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz
→ Nachschaffende Leistungsübernahme
→ Rufausbeutung
→ Rufschädigung
→ Einschieben in eine fremde Serie
→ Zeitliche Grenzend des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes
→ Herkunftstäuschung im weiteren Sinne
§ 4 Nr. 10 UWG → Verbot unlauterer Behinderung
Das Anbieten einer Nachahmung kann nach § 4 Nr. 3 UWG wettbewerbswidrig sein [→ unlautere Nachahmung], wenn das nachgeahmte Produkt wettbewerbliche Eigenart aufweist und besondere Umstände - wie eine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft (Buchst. a) [→ Vermeidbare Herkunftstäuschung] oder eine unangemessene Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung des nachgeahmten Produkts (Buchst. b) [→ Rufausbeutung, Rufschädigung] - hinzutreten, aus denen die Unlauterkeit folgt.1)
Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen.2)
Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Unlauterkeit der Nachahmung begründen und umgekehrt.3)
Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz dienen vorrangig dem Schutz individueller Leistungen und daneben dem Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb. Sie sollen grundsätzlich nur von demjenigen geltend gemacht werden können, der die zu schützenden Leistungen erbracht hat.4) [→ Anspruchsberechtigter im wettbewerblichen Leistungsschutz]
Durch die Vorschrift des § 4 Nr. 9 UWG 2004 ist der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz lediglich gesetzlich geregelt, nicht aber inhaltlich geändert worden, so dass die von der Rechtsprechung zu § 1 UWG in der zuvor bestehenden Fassung entwickelten Grundsätze weiterhin gelten.5). Das UWG 2008 hat insoweit keine Änderungen gebracht.6)
Gleiches gilt, soweit die Bestimmung des § 4 Nr. 9 UWG durch Art. 1 Nummer 4 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (BGBl. I 2015, S. 2158 f.) mit Wirkung ab dem 10. Dezember 2015 geändert worden ist.7). Der bisher in § 4 Nr. 9 UWG aF geregelte wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz findet sich nunmehr ohne inhaltliche Änderung in der Bestimmung des § 4 Nr. 3 UWG [→ Unlauteres Anbieten von Waren oder Dienstleistungen].8)
Der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz sieht keinen allgemeinen Nachahmungsschutz einer technisch bedingten Produktgestaltung vor, sondern dient der Absicherung eines konkreten Leistungsergebnisses vor Nachahmungen, die im Einzelfall aufgrund eines unlauteren Verhaltens des Mitbewerbers zu missbilligen sind. Damit können die formgebenden technischen Merkmale eines Erzeugnisses als Herkunftshinweis dienen, auch wenn sie zur Monopolisierung der Warenform als dreidimensionale Marke ungeeignet sind.9)
Bei der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor Herkunftstäuschungen sind Wertungswidersprüche zum Markenrecht (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG → Technisch bedingte Warenformen) zu vermeiden.10)
Die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung lässt Bestimmungen der Mitgliedstaaten über den unlauteren Wettbewerb unberührt (Art. 96 Abs. 1 GGV). Dazu zählen auch die Vorschriften über den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz, die sich gegen ein unlauteres Wettbewerbsverhalten richten. Von dieser Zielrichtung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb unterscheidet sich die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, die in der Form des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ein bestimmtes Leistungsergebnis schützt. Der zeitlich befristete Schutz für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster berührt daher nicht den zeitlich nicht von vornherein befristeten Anspruch aufgrund lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes.11)
siehe auch
Seiten-Werkzeuge
Konzept, Struktur und Gestaltung: © Dr. Martin Meggle-Freund
Nutzungsbedingungen - Hinweise zum Datenschutz
Impressum
Partnerprojekte: waidlerwiki.de - chiemgau-wiki.de