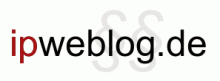Anzeigen:
Seitenleiste
Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist
Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
1. der Anspruch entstanden ist und
2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Dem Urheber kann ein grob fahrlässiges Verhalten im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB nicht allein aufgrund fehlender Marktbeobachtung angelastet werden.1)
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Anspruch im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB entstanden, sobald er erstmals geltend gemacht und im Wege der Klage durchgesetzt werden kann.2)
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die für den Beginn der Verjährung erforderliche Kenntnis im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB bei Ansprüchen auf Schadensersatz vorhanden, wenn dem Geschädigten die Erhebung einer Schadensersatzklage, sei es auch nur in Form der Feststellungsklage, Erfolg versprechend, wenn auch nicht risikolos, möglich ist.3)
Dabei ist weder notwendig, dass der Geschädigte alle Einzelumstände kennt, die für die Beurteilung möglicherweise Bedeutung haben, noch muss er bereits hinreichend sichere Beweismittel in der Hand haben, um einen Rechtsstreit im Wesentlichen risikolos führen zu können. Es muss dem Geschädigten lediglich zumutbar sein, aufgrund dessen, was ihm hinsichtlich des tatsächlichen Geschehensablaufs bekannt ist, Klage zu erheben, wenn auch mit dem verbleibenden Prozessrisiko, insbesondere hinsichtlich der Nachweisbarkeit von Schadensersatz auslösenden Umständen.4)
Dafür genügt es nicht, dass der Schuldner die anspruchsbegründenden Tatbestandsmerkmale verwirklicht hat und der Anspruch daher nach allgemeiner Terminologie entstanden ist.5) Vielmehr ist darüber hinaus grundsätzlich die Fälligkeit des Anspruchs erforderlich, die dem Gläubiger die Möglichkeit der Leistungsklage verschafft.6) Erst ab diesem Zeitpunkt kann der Gläubiger gemäß § 271 BGB die Leistung verlangen und nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB die Verjährung durch Klageerhebung hemmen.7)
Eine solche Auslegung des § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB folgt aus der Entstehungsgeschichte der Vorschrift. Der Gesetzgeber wollte an der bisherigen Rechtslage festhalten, dass die Verjährung grundsätzlich mit der Fälligkeit des Anspruchs beginnt. Durch die Wahl des Begriffs „Entstehung“ wollte er klarstellen, dass ein Schadensersatzanspruch weiterhin nach dem Grundsatz der Schadenseinheit auch hinsichtlich vorhersehbarer künftiger Schadensfolgen zu verjähren beginnt, sobald irgendein (Teil-)Schaden entstanden ist und gerichtlich geltend gemacht werden kann, obwohl der Anspruch bezüglich der drohenden Schäden nicht als fällig bezeichnet werden kann.8)
Bei strafrechtlich relevanten Sachverhalten kann aus dem Umstand, dass eine Strafanzeige erstattet worden ist, allerdings nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass der Anzeigeerstatter alle für die Geltendmachung eines zivilrechtlichen Schadensersatzanspruchs erforderlichen Kenntnisse hat. Je nach der Art des Schuldvorwurfs und der Komplexität des Falles können selbst Umstände, die zur Erhebung der Anklage und zur Eröffnung des Strafverfahrens führen, nicht ausreichend sein.9)
siehe auch
Seiten-Werkzeuge
Konzept, Struktur und Gestaltung: © Dr. Martin Meggle-Freund
Nutzungsbedingungen - Hinweise zum Datenschutz
Impressum
Partnerprojekte: waidlerwiki.de - chiemgau-wiki.de