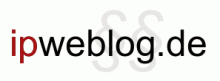Anzeigen:
Seitenleiste
Nächstliegender Stand der Technik
Ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, bestimmt sich nicht danach, ob es sich hierbei um den nächsten Stand der Technik handelt. Die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als - aus nachträglicher Sicht - nächstkommender Stand der Technik ist weder ausreichend noch erforderlich.1)
Die Wahl des Ausgangspunkts bedarf stets einer Rechtfertigung. Diese liegt in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt.2)
Gibt es mehrere Dokumente des Stands der Technik, von denen jede als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit infrage kommt, so ist die erfinderische Tätigkeit nach ständiger Rechtsprechung gegenüber all diesen Dokumenten zu prüfen, bevor eine die erfinderische Tätigkeit bestätigende Entscheidung getroffen wird.3)
Die Zuordenbarkeit des zu bestimmenden nächstliegenden Stands der Technik zu demselben Gebiet der Technik wie die beanspruchte Erfindung stellt nur eines von vielen Kriterien zur Feststellung des nächstliegenden Stands der Technik dar.4)
Bei Verneinung der erfinderischen Tätigkeit bedarf es im Prinzip keiner besonderen Begründung für die Vorauswahl von Entgegenhaltungen bedarf, auch wenn dem Fachmann mehrere gangbare Lösungswege zur Verfügung stehen. Vielmehr geht es allein darum, aufzuzeigen, dass sich die Erfindung für den Fachmann in Bezug auf mindestens einen dieser Lösungswege in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.5)
siehe auch
Artikel 54 (2) EPÜ → Stand der Technik
→ Aufgabe-Lösungs-Ansatz
Seiten-Werkzeuge
Konzept, Struktur und Gestaltung: © Dr. Martin Meggle-Freund
Nutzungsbedingungen - Hinweise zum Datenschutz
Impressum
Partnerprojekte: waidlerwiki.de - chiemgau-wiki.de