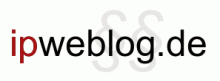Anzeigen:
Seitenleiste
Unbestimmter Rechtsbegriff
Ein unbestimmter Rechtsbegriff ist durch die Rechtssprechung auszufüllen. Der Gesetzgeber greift immer dann auf einen unbestimmten Rechtsbegriff zurück, wenn sich eine allgemeine Regelung aufgrund der Komplexität des zu regelnden Themas verbietet. Beispielsweise basiert das gesamte Wettbewerbsrecht auf dem unbestimmten Rechtsbegriff der „unlauteren Wettbewerbshandlung“ [→ Verbot unlauteren Wettbewerbs].
Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe
Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ist die Auslegung unbestimmter Gesetzesbegriffe als Rechtsfrage zu bewerten, die uneingeschränkt in eigener Verantwortung sowohl von der gesetzesanwendenden Verwaltungsbehörde zu beantworten als auch von dem die Rechtmäßigkeit der Anwendung überprüfenden Verwaltungsgericht zu erörtern ist.1)
Die Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe durch die Verwaltungsbehörde erfolgt auch bei schwierigen Wertungen und Zukunftsprognosen durch eine bestimmte Entscheidung im konkreten Einzelfall.2)
siehe auch
Seiten-Werkzeuge
Konzept, Struktur und Gestaltung: © Dr. Martin Meggle-Freund
Nutzungsbedingungen - Hinweise zum Datenschutz
Impressum
Partnerprojekte: waidlerwiki.de - chiemgau-wiki.de