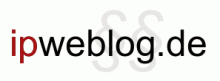Anzeigen:
Seitenleiste
Persönliche geistige Schöpfung
Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.
§ 2 (1) UrhG → Geschützte Werke
→ Erforderliche Schöpfungshöhe bei Werken der Baukunst
→ Erforderliche Gestaltungshöhe bei Werken der angewandten Kunst
Für den Schutz als urheberrechtliches Werk ist der Begriff der persönlichen geistigen Schöpfung im Sinne von § 2 Abs. 2 UrhG beziehungsweise der eigenen geistigen Schöpfung im Sinne des unionsrechtlichen Werkbegriffs maßgeblich.1)
Eine persönliche geistige Schöpfung ist eine Schöpfung individueller Prägung, deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht hat, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer „künstlerischen“ Leistung gesprochen werden kann.2)
Dabei kann die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen, soweit sie auf einer künstlerischen Leistung beruht und diese zum Ausdruck bringt.3)
In der Sache entsprechen diese Maßstäbe dem unionsrechtlichen Begriff des urheberrechtlich geschützten Werks im Sinne der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft4). Dabei handelt es sich um einen autonomen Begriff des Unionsrechts, der in der gesamten Union einheitlich auszulegen und anzuwenden ist5).6)
Für eine Einstufung eines Objekts als Werk müssen zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss es sich bei dem betreffenden Gegenstand um ein Original in dem Sinne handeln, dass er eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers darstellt.7)
Ein Gegenstand kann erst dann, aber auch bereits dann als ein Original in diesem Sinne angesehen werden, wenn er die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie kreative Entscheidung zum Ausdruck bringt. Wurde dagegen die Schaffung eines Gegenstands durch technische Erwägungen, durch Regeln oder durch andere Zwänge bestimmt, die der Ausübung künstlerischer Freiheit keinen Raum gelassen haben, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Gegenstand die für die Einstufung als Werk erforderliche Originalität aufweist.8)
Zum anderen ist die Einstufung als Werk Elementen vorbehalten, die eine solche Schöpfung zum Ausdruck bringen.9) Dafür ist ein mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbarer Gegenstand Voraussetzung10), auch wenn diese Ausdrucksform nicht notwendig dauerhaft sein sollte11).12)
Schutzfähig sind gemäß § 2 Abs. 2 UrhG nur Werkschöpfungen, die eine Ausdrucksform gefunden haben, die durch die menschlichen Sinne unmittelbar oder mittelbar unter Zuhilfenahme technischer Einrichtungen wahrgenommen werden kann.13)
Ob den Anforderungen, die an schutzfähige Werke zu stellen sind, im Einzelfall genügt ist, bleibt weitgehend eine Frage tatrichterlicher Würdigung.14)
Es ist in der Revisionsinstanz jedoch zu überprüfen, ob die Beurteilung des Berufungsgerichts von den von ihm getroffenen Feststellungen getragen wird. Hierzu muss das Berufungsurteil eine revisionsrechtlich nachprüfbare Begründung enthalten. Erforderlich ist vor allem, dass der für die Feststellung der Schutzfähigkeit entscheidende Gesamteindruck und die ihn tragenden einzelnen Elemente nachvollziehbar dargelegt werden.15)
Schöpfungshöhe (auch Gestaltungshöhe)
Im Blick auf die lange urheberrechtliche Schutzfrist - das Urheberrecht erlischt gemäß § 64 UrhG siebzig Jahre nach dem Tode des Urhebers - ist es geboten, für den urheberrechtlichen Schutz eine nicht zu geringe Gestaltungshöhe zu fordern.16)
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei Werken der zweckfreien bildenden Kunst - ebenso wie im Bereich des literarischen und musikalischen Schaffens - die sogenannte kleine Münze anerkannt, die einfache Schöpfungen umfasst.17)
An den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst sind grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens. Es genügt daher, dass sie eine Gestaltungshöhe erreichen, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer „künstlerischen“ Leistung zu sprechen.18)
Rechtsprechnung des Gerichtshof der Europäischen Union
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat aus dem Umstand, dass die Richtlinie 2001/29/EG einen harmonisierten Rechtsrahmen des Urheber-rechts festlegt, geschlossen, der in dieser Richtline vorausgesetzte Werkbegriff beruhe auf demselben Grundsatz wie derjenige der Richtlinie 2009/24/EG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, der Richtlinie 96/9/EG über den rechtlichen Schutz von Datenbanken und der Richtlinie 2006/116/EG über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte. Das Urheberrecht im Sinne der Richtlinie 2001/29/EG könne daher nur in Bezug auf ein Schutzobjekt angewandt werden, bei dem es sich um ein Original in dem Sinne handele, dass es eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers darstelle.19) Demnach können die in der Richtlinie 2001/29/EG geregelten Verwertungsrechte auch an einem Werk der angewandten Kunst nur bestehen, wenn es sich dabei um eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers handelt.20)
Zur Bestimmung der Schutzfähigkeit von Computerprogrammen, Datenbankwerken und Lichtbildwerken sind gemäß Art. 1 Abs. 3 Satz 2 der Richt-linie 2009/24/EG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, Art. 3 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 96/9/EG über den rechtlichen Schutz von Datenbanken und Art. 6 Satz 2 der Richtlinie 2006/116/EG über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte keine anderen Kriterien als die der „eigenen geistigen Schöpfung“ anzuwenden. Damit ist gemeint, dass der Urheberrechtsschutz dieser Werkarten nicht von einer besonderen Gestaltungshöhe abhängig gemacht werden darf.21)
Für andere Werkarten sieht das Urheberrecht der Europäischen Union keine derartige Einschränkung vor. Soweit der Gerichtshof es für möglich gehal-ten hat, dass bereits elf aufeinander folgende Wörter eines Zeitungsartikels eine geistige Schöpfung darstellen22)), folgt daraus nicht, dass auch der Urheberrechtsschutz von Sprachwerken oder anderen Werkarten nicht von einer bestimmten Gestaltungshöhe abhängig gemacht werden darf. Im Übrigen hat der Gerichtshof die Prüfung der Frage, ob es sich bei einem bestimmten Gegenstand nach den von ihm aufgestellten Maßstäben um eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers handelt, in diesem Fall wie auch in anderen Fällen den nationalen Gerichten zugewiesen.23)
Im Blick auf Werke, die - wie insbesondere Werke der angewandten Kunst - einem Geschmackmusterschutz zugänglich sind, geht zudem aus Art. 17 der Richtline 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen eindeutig hervor, dass die Mitgliedstaaten berechtigt sind, deren urheberrechtlichen Schutz von einer besonderen Gestaltungshöhe abhängig zu machen24). Gemäß Art. 17 Satz 1 der Richtlinie 98/71/EG ist das Muster, das nach Maßgabe dieser Richtlinie durch ein - in einem oder mit Wirkung für einen Mitgliedstaat - eingetragenes Recht an einem Muster geschützt ist, auch nach dem Urheberrecht dieses Staates von dem Zeitpunkt an schutzfähig, zu dem das Muster geschaffen oder in irgendeiner Form festgelegt wurde. In welchem Umfang und unter welchen Bedingungen ein solcher Schutz gewährt wird, wird gemäß Art. 17 Satz 2 der Richtlinie - einschließlich der erforderlichen Gestaltungshöhe - von dem einzelnen Mitgliedstaat festgelegt25). Bereits aus diesem Grund lässt der Umstand, dass der Gerichtshof es für möglich gehalten hat, dass die grafische Benutzerfläche eines Computerprogramms eine geistige Schöpfung darstellt, ohne eine bestimmte Gestaltungshöhe als Schutzvoraussetzung zu erwähnen26), nicht darauf schließen, dass an die Gestaltungshöhe eines Werkes der angewandten Kunst keine besonderen Anforderungen gestellt werden dürfen.27)
Verhältnis zum Geschmacksmusterschutz
Geschmacksmusterschutz und Urheberrechtsschutz schließen sich nicht aus, sondern können nebeneinander bestehen28). Sie haben nicht nur verschiedene Schutzrichtungen, sondern auch unterschiedliche Schutzvoraussetzungen und Rechtsfolgen.29)
Der Umstand, dass eine Gestaltung dem Geschmacksmusterschutz zugänglich ist, rechtfertigt es daher nicht, ihr den Urheberrechtsschutz zu versagen oder von besonderen Voraussetzungen abhängig zu machen.30)
Durch die Gewährung von Urheberrechtsschutz wird der Geschmacksmusterschutz auch nicht überflüssig. Eine Gestaltung kann aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit zum vorbekannten Formenschatz einem Geschmacksmusterschutz zugänglich sein, ohne die für einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe zu erreichen.31)
Nachdem das Geschmacksmusterrecht durch das Geschmacksmusterreformgesetz vom 12. März 2004, mit dem die Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen umgesetzt wurde, neu gestaltet worden ist, besteht zwischen dem Geschmacksmusterrecht und dem Urheberrecht kein Stufenverhältnis mehr in dem Sinne, dass das Geschmacksmusterrecht den Unterbau eines wesensgleichen Urheberrechts bildet. Mit einem solchen Stufenverhältnis können die erhöhten Anforderungen an den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst daher nicht mehr begründet werden.32)
Ein deutliches Überragen der Durchschnittsgestaltung als Voraussetzung des Urheberrechtsschutzes von Werken, die einem Geschmacksmusterschutz zugänglich sind, lässt sich auch nicht damit begründen, dass mit dem Geschmacksmuster - und insbesondere mit dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Art. 1 Abs. 2 Buchst. a GGV), das für eine Frist von drei Jahren geschützt ist (Art. 11 GGV) - unabhängig von der jeweiligen Schutzrichtung des Urheberrechts einerseits und des Geschmacksmusterrechts andererseits eine wesensadäquate Schutzform für Gestaltungen geringer Eigenart besteht.33)
Bei der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit handelt es sich um eine Frage der Rechtsanwendung. Für die Feststellung der dieser rechtlichen Beurteilung zugrundeliegenden tatsächlichen Voraussetzungen gelten die allgemeinen Regeln gemäß § 286 ZPO.34). Dabei ist davon auszugehen, dass Mitglieder eines fachspezifischen Spruchkörpers regelmäßig hinreichenden Sachverstand haben, um die Schutzfähigkeit und Eigentümlichkeit eines Werks der bildenden Kunst zu beurteilen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Anspruchsteller sich für den behaupteten Rang des Werks auf dessen Eindruck und Form und nicht auf die Beurteilung in der Kunstwelt stützt.35)
Geht es - wie beispielsweise bei der Innenraumgestaltung eines Bauwerks - um ein Werk, bei dem es im Wesentlichen auf den sich aufgrund der Betrachtung des Objekts ergebenden Gesamteindruck ankommt, der sich oft einer genauen Wiedergabe durch Worte entzieht, kann der Kläger seiner Darlegungslast auch durch Vorlage von Fotografien des Werks genügen, wenn die maßgeblichen Umstände hierauf ausreichend deutlich zu erkennen sind.36)
siehe auch
§ 2 (1) UrhG → Geschützte Werke
Seiten-Werkzeuge
Konzept, Struktur und Gestaltung: © Dr. Martin Meggle-Freund
Nutzungsbedingungen - Hinweise zum Datenschutz
Impressum
Partnerprojekte: waidlerwiki.de - chiemgau-wiki.de